Ich arbeite als Texter für die Behindertenhilfe. Meine Auftraggeber*innen wissen: Ich ziehe Einfache Sprache der Leichten vor. Der Grund ist einleuchtend. Ich habe die Flexibilität für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu schreiben, die Einfache Sprache lesen können. Ich kann aber genauso auf dem Niveau der Leichten Sprache schreiben. Das fällt trotzdem in den Regelbereich der Einfachen Sprache.
Die Leichte Sprache hat einen großen Nachteil: Sie geht von einem einheitlichen Bildungsniveau bei Menschen mit Lernschwierigkeiten aus. Autisten inklusive. Dass eine solche Pauschalierung nicht stimmt, muss ich hier nicht begründen. Jüngere haben eine gute Schulbildung und Lesen gehört zu ihrem Alltag.
Siehe auch: DIN ISO: Neue Dimension mit Einfacher Sprache
Gehen sie hochmotiviert zum Beispiel in ein Museum, dann bekommen sie ein Faltblatt in Leichter Sprache in die Hand gedrückt. Alterative sind Texte an den Exponaten, die jenseits der Einfachen Sprache sind. Wie oft lese ich Kritiken, in denen die Ausstellungsstücke gelobt werden, die Erklärungen dazu aber unterirdisch seien. Kuratoren betonen, dass sie die volle Breite der Bevölkerung für ihr Museum interessieren wollen. Doch die Einfache Sprache haben sie zur Motivation leider noch nicht entdeckt.
Ziehe Einfache Sprache wegen ihrer Flexibilität vor
Ich ziehe aus vielen Gründen Einfache Sprache der Leichten vor: Die Einfache Sprache ist ein flexibles Instrument, Texte dem Sprachen-Niveau der jeweiligen Zielgruppe anzupassen. Nach der internationalen DIN ISO 24495-1 ist Einfache Sprache/Plain Language nicht für eine bestimmte Zielgruppe gedacht, sondern sie ist universell einsetzbar.
Der Grundsatz der DIN ISO 24495-1 Einfache Sprache/Plain Language lautet: Texte müssen schnell erfassbar und verstehbar sein. Sie müssen der Lese-Erwartung entsprechen.
Leichte Sprache ist nach der Definition der künftigen DIN SPEC 33429 für Menschen mit Lernschwierigkeiten/kognitiver Einschränkung gedacht. Sie unterliegt strengen Vorgaben: Sätze dürfen zum Beispiel nicht mehr als zehn Wörter und keine Nebensätze haben. Wenn Autor*innen darüber hinaus gehen, bewegen sie sich außerhalb der Leichte-Sprache-Regeln.
Leichte Sprache: Scheitern an Regeln
Einfache Sprache gibt Autor*innen hingegen mehr Freiheiten. Die Zahl der Wörter pro Satz bewegt sich von sehr wenigen bis zu etwa 20 Wörtern. Ein Nebensatz ist erlaubt.
Einfache Sprache kann sich ohne Regel-Verstoß im Bereich der Leichten Sprache bewegen. Umgekehrt ist das nicht möglich. Gerät der Autor oder die Autorin mit der Leichten Sprache in den Bereich der Einfachen Sprache, ist das ein Regelverstoß. Viele Texte in Leichter Sprache sind bei genauer Betrachtung tatsächlich in Einfacher Sprache. Die strengen Regeln der Leichten Sprache sind eine Herausforderung, die wenige (begabte) Autor*innen meistern. Das stellt die Frage, ob die künftige DIN überhaupt ernstgenommen wird.
Nachrichten in Leichter Sprache sind merkwürdig
Ein Beispiel des Scheiterns sind die Informationen der Bundesregierung in Leichter Sprache. Diese wird vom Bundespresse-Amt betreut. Mein erster Gedanke war, Nachrichten in Leichter Sprache sind merkwürdig.
Ich werde immer wieder gefragt, warum ich nicht in Leichter Sprache schreibe, wenn ich Aufträge aus der Behindertenhilfe habe. Da ich als Journalist Inhalte verkaufe und keinen Schreibstil, lehne ich Textaufträge ab, in denen so gut wie keine Informationen transportiert werden sollen.
Für unsere Gewaltschutzkonzepte nutzen wir die Flexibilität der Einfachen Sprache: Verhaltensregeln, an die sich alle halten müssen, sind besonders leicht verständlich formuliert. Das kann (fast) Leichte Sprache sein. Für den Handlungsleitfaden und den Ehrenkodex ist die Einfache Sprache komplexer, aber ohne Regelverstoß.
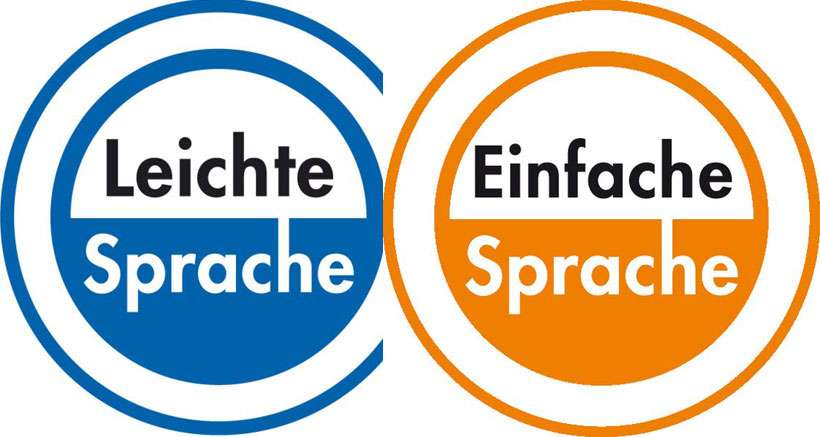
Schreibe einen Kommentar